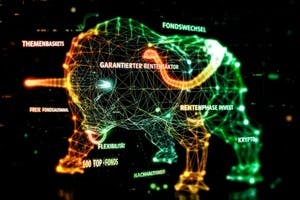Versicherer verlassen sich zunehmend auf Künstliche Intelligenz, um Risiken besser zu berechnen und Schäden zu verhindern. Doch wo liegen die Grenzen dieser Technik? In Teil 2 der Serie „Vom Risikoträger zum Präventionspartner: Die neue Rolle der Versicherung“ zeigt Prof. Dr. Stefan Heinemann, wie KI Ungewissheit verringern kann – und warum Versicherer dennoch immer auf das Unerwartete vorbereitet sein müssen.
Artikel von:
Prof. Dr. Stefan Heinemann
KI-Experte und Professor für Wirtschaftsethik an der FOM Hochschule
Risiko und Ungewissheit im KI-Zeitalter
Frank Hyneman Knight war der erste Forscher, der diese Thematik systematisch untersuchte. In seiner 1916 verfassten Dissertation beschäftigte sich der spätere Dekan der angesehenen Wirtschaftsfakultät der Universität Chicago mit dem Begriff des Gewinns. Nach einer Überarbeitung erschien die Arbeit 1921 unter dem neuen Titel «Risk, Uncertainty and Profit» und entwickelte sich zu einem der am häufigsten zitierten Grundlagenwerke der Volkswirtschaftslehre – eine echte Leseempfehlung! Seine Unterscheidung von Risiko (berechenbar) und Ungewissheit (nicht berechenbar) ist wohl zeitlos. Knight sagte sinngemäß: Risiko ist, wenn wir die Wahrscheinlichkeiten kennen; Ungewissheit ist, wenn wir sie nicht kennen. Die Versicherung konnte historisch nur mit Risiken umgehen, nicht mit echter Ungewissheit – denn man braucht Statistiken, Tabellen, Erfahrungsmaterial. Ist es vermessen zu glauben, KI könne aus Ungewissheit Risiko machen? Ein Teil von mir hofft es fast, denn je mehr wir berechnen können, desto besser können wir uns vorbereiten. Tatsächlich kann KI durch riesige Datenmengen und selbstlernende Algorithmen Muster entdecken, wo früher Chaos war. Dinge, die wir früher der Ungewissheit zugeschrieben hätten – weil wir einfach nicht genug wussten –, werden auf einmal prognostizierbar. Beispielsweise in der Medizin: KI-Modelle können Krankheitsrisiken sehr individuell vorhersagen, wo früher oft Ungewissheit herrschte. Oder in der Wetter- und Klimamodellierung, was ja für Versicherung auch relevant ist: Wir können Stürme besser vorhersagen als noch vor Jahrzehnten. Hier wandelt sich tatsächlich ein Stück Ungewissheit in berechenbares Risiko um.
Aber, und hier bin ich vielleicht ein Stück weit skeptisch oder demütig und mag meine temperierte Endlichkeit: Es wird immer einen Rest von Ungewissheit geben. Knight’sche Ungewissheit ist sowas wie das „Echo des Unbekannten“, das uns immer begleiten wird. Gerade wenn wir uns auf KI verlassen, besteht die Gefahr, dass wir blind werden für das, was die KI nicht erfasst. Stellen wir uns vor, wir haben ein perfektes Modell für heutige Risiken – dann kommt plötzlich ein völlig neuer Risikotyp um die Ecke, den niemand auf dem Schirm hatte. Ein Black Swan, um Nassim Taleb zu benennen. Die KI hätte ihn nicht vorhergesagt, weil es keine historischen Daten gab. Pandemien sind so ein Beispiel: Vor COVID-19 war eine globale Pandemie für viele eher abstrakte Ungewissheit. Jetzt, nachträglich, versuchen wir, sie in Modelle zu fassen – also wieder Risiko draus zu machen. Das heißt: KI verschiebt die Grenze zwischen Risiko und Ungewissheit, aber sie löscht sie nicht aus.
Für Versicherer bedeutet das, sie müssen auf zwei Ebenen denken. Erstens: Bekannte Risiken werden immer besser beherrschbar, feingranularer berechenbar – da muss man mithalten, sonst schlägt der competitive disadvantage zu. Zweitens: Ungewissheiten – also das, was wir noch nicht im Griff haben – bleiben die eigentliche Herausforderung, vielleicht sogar mehr denn je. Denn je mehr wir scheinbar kontrollieren, desto schmerzhafter sind die Bereiche, die wir nicht kontrollieren. Ich halte Knights Unterscheidung zudem auch für ethisch relevant. Wir dürfen als Versicherer nicht überheblich werden zu glauben, wir könnten alles vorhersehen. Es gehört zum verantwortungsvollen Umgang mit KI, die eigenen Grenzen zu kennen. In der Praxis könnte das heißen, KI zu nutzen, um aus Ungewissheit so viel Risiko zu machen wie möglich – aber wir planen immer auch für den Fall, dass etwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Das ist ja letztlich der tiefe Sinn der Versicherung: für Überraschungen gewappnet zu sein. KI ändert daran grundsätzlich nichts, sie verschiebt nur die Frontlinie ein Stück weiter ins Unbekannte hinein.
Prävention in der Praxis
So ist denn eine stärkere Orientierung an Prävention kein schlechter, strategischer Gedanke. Da tut sich in den letzten Jahren wirklich einiges. Ich finde es spannend zu beobachten, wie Versicherer anfangen, kreativ präventiv zu denken. Ein sehr greifbares Beispiel ist die Telematik in der Kfz-Versicherung. Viele Versicherer bieten Telematik-Tarife an, bei denen ein kleines Gerät im Auto – oder oft einfach eine App auf dem Smartphone – das Fahrverhalten aufzeichnet. Fährt man umsichtig und defensiv, erhält man Punkte oder Rabatte. Dahinter steckt die Idee: Wir wollen den Kunden zu sichererem Fahren motivieren. Es ist fast so, als säße der Versicherer mit im Auto und würde leise sagen: „Brich bitte nicht die Verkehrsregeln, es lohnt sich für dich.“ Natürlich tut er das indirekt über finanzielle Anreize, aber der Effekt ist real: Jüngere Fahrer beispielsweise, so zeigt sich, fahren tatsächlich vorsichtiger, wenn sie wissen, dass ihre Fahrdaten getrackt werden und sich auf den Preis auswirken. Freilich ist dies sorgsam abzuwägen mit dem legitimen Recht nach Privatheit. Die Erfassung detaillierter Verhaltensdaten wirft immer Fragen des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung auf. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie technologische Möglichkeiten zur Risikominimierung mit anderen gesellschaftlichen Werten in Einklang gebracht werden müssen.
Ein anderes Feld ist die Gesundheitsvorsorge. Kranken- und Lebensversicherer setzen zunehmend auf Programme, die gesundes Verhalten belohnen. Man kennt das von manchen privaten Krankenversicherungen oder Zusatzversicherungen: Da gibt es Apps, die Schrittzahlen messen, Ernährungstipps geben, sogar Challenges veranstalten – und wer da engagiert mitmacht, bekommt am Jahresende einen Teil der Prämie zurück oder andere Vorteile. Die Idee dahinter fasziniert. Der Versicherer wird zum Gesundheits-Coach. Er hat ja auch ein finanzielles Interesse, dass der Kunde gesund bleibt – jeder vermiedene Krankenhausaufenthalt ist gut für beide Seiten. Es entsteht so etwas wie eine Win-Win-Situation: Der Kunde profitiert gesundheitlich, der Versicherer spart Kosten. In der Theorie zumindest. In der Praxis muss man schauen, wie gut das funktioniert, aber die Ansätze sind da. Die ethische Dimension – Datenschutz, mögliche Diskriminierung, Druck zur Selbstoptimierung – ist hier, ähnlich wie bei der Telematik, ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der sorgfältig bedacht werden muss. Tiefe Heilung kann nur legal, legitim und wirtschaftlich zusammen gelingend gedacht und gemacht werden in einer Welt, die wir nicht erschaffen haben.
Auch im Bereich Wohngebäude und Hausrat sehen wir Prävention. Einige Versicherer kooperieren mit Smart-Home-Anbietern. Man bekommt zum Beispiel einen Wassersensor fürs Badezimmer gestellt – wenn der Sensor austretendes Wasser erkennt – weil vielleicht die Waschmaschine ausläuft – schlägt er Alarm und O stoppt im besten Fall das Wasser, bevor die Wohnung geflutet wird. Oder Rauchmelder, die vernetzt sind und direkt die Feuerwehr rufen, wenn man selbst nicht zuhause ist. Früher hätte ein Versicherer einfach den Brandschaden bezahlt; heute sagt er: „Lieber Kunde, nimm doch diese Technik, damit es gar nicht erst brennt – wir unterstützen dich dabei.“ Das ist schon ein anderes Selbstverständnis.
Nicht zu vergessen: Risiko-Training und Beratung. Viele gewerbliche Versicherer bieten ihren Firmenkunden Schulungen an, z.B. wie Mitarbeitende sicherer arbeiten, um Arbeitsunfälle zu vermeiden, oder wie Cyberangriffe verhindert werden können. Der Versicherer nutzt sein Know-how, um den Kunden stärker zu machen im Umgang mit Risiken. Das hat auch einen vertrieblichen Charme: Man ist im kontinuierlichen Kontakt mit dem Kunden, nicht nur einmal im Jahr bei der Rechnung oder beim Schadenfall. Ich beobachte all das mit vorsichtigem Optimismus. Der Optimist glaubt, das wir in der besten aller möglichen Welten leben, der Pessimist hat Sorge, es könnte wahr sein. Es zeigt sich, dass Versicherer mehr sein können als nur Zahlmeister. Sie können tatsächlich Schadenverhüter sein. Allerdings ist das noch lange nicht flächendeckend. Viele solche Initiativen sind noch in Pilotprojekten oder erreichen nur die technikaffinen Kunden. Werden diese präventiven Angebote von den Kunden als Mehrwert gesehen, oder empfinden manche es als lästig, bevormundend, vielleicht auch unheimlich, dass die Versicherung so viel über einen wissen will? Die heutige präventive Rolle der Versicherer ist also ambivalent: einerseits sehr vielversprechend, andererseits ein Balanceakt, um Akzeptanz und Vertrauen zu erhalten. Aber die Richtung ist für mich klar erkennbar – die Branche tastet sich Schritt für Schritt in Richtung Schadenvermeidung vor.
Verantwortung und Grenzen der Prävention
Aber natürlich kann und sollte man auch hier fragen: Wie weit darf eine Versicherung gehen, wenn sie präventiv auf das Verhalten ihrer Kunden Einfluss nimmt? Wo endet kundenfreundliche Vorsorge – und wo beginnt die algorithmisch gesteuerte Verhaltenslenkung? Diese Sorge ist absolut berechtigt und ich teil sie bis zu einem gewissen Grad. Es gibt sicherlich eine Grenze des Zumutbaren, jenseits derer Prävention in Bevormundung umschlägt. Als Versicherer möchte ich natürlich, dass meine Kunden gesund und sicher leben – klar, das reduziert Schäden. Aber ich muss mich fragen: Wie weit darf ich gehen? Menschen haben ein Recht auf Autonomie und darauf, auch mal unvernünftige Entscheidungen zu treffen, ohne dafür gleich finanziell abgestraft zu werden. Wenn ich jeden Schritt, jede Verhaltensweise überwache und bewerte, wird das schnell dystopisch. Da entsteht ein ungutes Gefühl von Überwachung.
Nehmen wir den Telematik-Tarif von eben: Für manche junge Fahrer ist das ein Anreizspiel und sogar spaßig. Andere sagen vielleicht: „Ich will nicht, dass meine Versicherung jede meiner Bremsungen analysiert.“ Und ich kann das verstehen. Privatsphäre und Vertrauen sind hier zentrale Stichworte. Die Grenze ist erreicht, wo der Kunde das Gefühl hat, er verliert die Kontrolle über sein Leben an die Versicherung. Wir müssen sehr fein austarieren, wie viel Einfluss wir nehmen. Ideal ist, wenn der Kunde die präventiven Angebote freiwillig annimmt, weil er ihren Wert erkennt – nicht, weil er sich gezwungen fühlt. Eine Belohnung für gutes Verhalten wirkt anders als eine Bestrafung für schlechtes. Ethik kommt hier ins Spiel: Ist es gerecht, jemanden, der ungesund lebt, mit hohen Prämien zu „bestrafen“? Oder sollten wir als Kollektiv gewisse Risiken weiterhin gemeinsam tragen, ohne individuelle Zuschläge, um Solidarität zu wahren? Das sind heikle Fragen.
Ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir in der Euphorie der technischen Möglichkeiten vergessen könnten, was Versicherung sozial bedeutet. Sie hat ja auch einen Fürsorge-Aspekt. Sie lässt Menschen Freiheiten, weil im Notfall Hilfe da ist. Wenn wir präventiv alles so steuern, dass niemand mehr einen Fehler machen darf, berauben wir Menschen vielleicht auch eines Stückchens Freiheit oder Lebensfreude. Ein einfaches Beispiel: Soll meine Unfallversicherung mir irgendwann sagen dürfen: „Fahr kein Ski, das ist uns zu riskant, sonst erhöhen wir den Beitrag“? Das wäre dann kein entspannter Urlaub mehr.
Daher plädiere ich dafür, die Grenzen sehr respektvoll zu behandeln. Technisch könnten wir vielleicht bald sehr viel machen – jemanden 24/7 überwachen und optimal steuern. Aber gesellschaftlich wollen wir das nicht, mit Recht. Die Kunst wird sein, Prävention anzubieten, aber nicht aufzuzwingen. Dies berührt sich auch mit dem herausfordernden Thema der Gesundheitskompetenz aller – Public Health Literacy ist ein rares Gut. Und es wird immer Bereiche geben, wo wir bewusst keine personalisierten Unterschiede machen, um Gemeinschaftlichkeit zu bewahren. Ich denke, ein mündiger Kunde soll am Ende entscheiden können, inwieweit er solche Angebote nutzt. Daher ist es auch geboten als institutioneller Akteur, sich noch über das rechtlich Notwendige aus moralischen Gründen für eine starke Aufklärung der Kunden einzusetzen und so eine robuste gesellschaftliche licence to operate zu erwerben. Die Versicherer werden lernen müssen, dass langfristiges Vertrauen wichtiger ist als der kurzfristige Effekt maximaler Verhaltenskontrolle. Letztlich lebt Prävention von Anreizen und Empfehlungen, nicht von Vorschriften. Genau dort verläuft für mich die Grenze: beim Respekt vor der Selbstbestimmung des Kunden. Und den dürfen wir auf keinen Fall überschreiten, wenn Prävention ein Erfolg sein soll.
Hier geht’s zum ersten Teil des Beitrages …
Den Beitrag lesen Sie auch in der AssCompact August-Ausgabe!
zurück zur Übersicht
Beitrag speichern
sharing is caring
Das könnte Sie auch interessieren