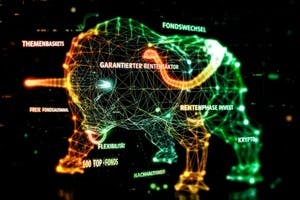Versicherungsschutz in Echtzeit, maßgeschneidert auf das Verhalten jedes Einzelnen – was technologisch möglich ist, wirft ethische Fragen auf. In Teil 3 der Serie „Vom Risikoträger zum Präventionspartner“ beleuchtet Prof. Dr. Stefan Heinemann, wie sich Versicherungen durch KI und Automatisierung verändern – und warum der Mensch dabei nicht zur Nebensache werden darf.
Artikel von:
Prof. Dr. Stefan Heinemann
KI-Experte und Professor für Wirtschaftsethik an der FOM Hochschule
Hyperpersonalisierung, dynamische Preise, Ethik und Recht
Wenn jeder Kunde seinen „eigenen Preis“ zahlt – in Echtzeit und datengetrieben, mag diese Vorstellung verlockend sein – und auch ein bisschen unheimlich, finde ich. Hyperpersonalisierung heißt ja im Grunde: Jede Versicherung wird zum Maßanzug, geschneidert aus Daten in Echtzeit. In der Tat experimentieren Versicherer längst damit. Wir hatten ja das Beispiel Pay-as-you-drive: da zahlt man quasi pro Fahrminute und Fahrstil. Man könnte es weiterdenken: Pay-as-you-live – zahle je nach deinem aktuellen Lebensstil, deinem aktuellen Risiko. Oder eben Präzisionsprävention in der Medizin. Rein technisch spricht wenig dagegen. Wenn meine Smartwatch gerade meldet, mein Puls ist hoch und ich bewege mich auf eine gefährliche Kreuzung zu, könnte – überspitzt gesagt – die Unfallversicherung für die nächsten fünf Minuten ein paar Cent teurer werden. Dynamische Preiskalkulation in Reinkultur. Statische Jahresverträge wirken da fast wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.
Aber ich möchte das etwas einordnen. Bisher sind den meisten Kunden allzu sprunghafte Preise eher suspekt. Man schließt Versicherung ja auch ab, um Planungssicherheit zu haben. Wenn der Preis permanent oszilliert wie ein Aktienkurs, wäre das schwer vermittelbar. Ich denke, wir werden eine Mischform sehen: sehr individuell angepasste Polizzen, die aber in gewissen Bandbreiten stabil bleiben. Vielleicht gibt es künftig Grundtarife, die sich quartalsweise anpassen anhand deines Verhaltens oder neuer Daten – nicht minütlich, aber deutlich öfter als heute. Auf jeden Fall dürfte die Segmentierung viel feiner werden: Das Konzept der “Kollektive” könnte sich verändern, weil im Extremfall jeder Kunde sein eigenes Risikokollektiv ist. Das Ende der Standard-Police – ja, ich sehe schon, dass wir in diese Richtung gehen. Es liegt wohl daran, dass es lange technisch und administrativ gar nicht anders machbar war. Doch mit KI und automatisierten Prozessen fallen diese Barrieren.
Vom Kollektiv zur Preisformel?
Hyperpersonalisierung hat aber auch Schattenseiten, über die wir uns Rechenschaft abgeben sollten. Wenn jeder genau das zahlt, was er statistisch verursacht, gibt es kaum noch einen solidarischen Ausgleich. Die guten Risiken werden supergünstig versichert, die schlechten Risiken vielleicht unerschwinglich teuer. Da stellt sich eine m.E. unabweisbare Gerechtigkeitsfrage: Wollen wir eine Welt, in der Risikotransfer nur noch nach strengem Individualmaßstab erfolgt? Oder verlieren wir da etwas Wesentliches, nämlich den sozialen Ausgleich, den Versicherung traditionell hatte? Es kann auch sein, dass Regulierer hier eingreifen und sagen: Bestimmte Merkmale dürfen nicht zur Differenzierung herangezogen werden, um Diskriminierung zu vermeiden. Schon heute dürfen Krankenversicherer z.B. in vielen Ländern genetische Informationen nicht verwenden, selbst wenn sie viel vorhersagen würden – aus gutem Grund.
Trotzdem: Ich sehe enorme Vorteile in personalisierten und dynamischen Angeboten. Kunden bekommen maßgeschneiderten Schutz, zahlen vielleicht insgesamt fairere Preise, weil keiner mehr pauschal für andere mitzahlt, außer es ist gewollt. Und Versicherer können Risiken genauer steuern und vielleicht profitabler wirtschaften, wenn sie wissen, wo sie stehen.
Zusammengefasst glaube ich: Die Standard-Police, wie wir sie kannten, wird in vielen Bereichen verschwinden oder sich stark verändern. Stattdessen gibt es flexible Policen, die sich meinem Leben anpassen. Vielleicht kaufe ich in Zukunft gar keine „Versicherungspolice“ mehr, sondern Versicherungsschutz ist etwas, das mich einfach umgibt und sich laufend aktualisiert, ohne dass ich jedes Mal neu unterschreiben muss. Wie ein Abo-Modell oder ein dynamischer Vertrag. Das Jahr 2030, was ja nicht mehr so fern ist, könnte uns bereits einige solcher Produkte im Mainstream bescheren. Die Herausforderung wird sein, sie so zu gestalten, dass Menschen sie verstehen und sich fair behandelt fühlen. Denn nur weil etwas hochpersonalisiert ist, heißt es ja nicht automatisch, dass der Kunde es auch als gerecht wahrnimmt. Hier muss die Branche viel ausprobieren und lernen.
Der Mensch in der KI-gesteuerten Versicherungswelt
Bei allem lernen: Welche Rolle bleibt dem Menschen in einer Branche, in der zunehmend automatisiert beraten, reguliert und verwaltet wird? Wird der Mensch zum Vertrauensanker – oder doch eher zum Kostenfaktor? Das ist eine Frage, die gewiss viele Menschen beunruhigt – zu Recht. Ich bin fest davon überzeugt: Der Mensch wird nicht überflüssig, aber seine Rolle wird sich dramatisch wandeln. Schauen wir zunächst nüchtern auf die Fakten: KI und Automatisierung können in der Tat zahlreiche Routineaufgaben schneller und fehlerfreier erledigen als wir – und mehr als das. Dokumente prüfen, Schäden nach Schema regulieren, Standard-Anfragen beantworten – all das kann (und wird) KI übernehmen. Aber auch selber Agent sein, handeln, sogar physisch als Roboter (der brownfield funktioniert, wie Agenten, das ist die Pointe). Und als emphatisch wahrgenommen werden – emphatischer als mancher Mensch. Viele Versicherungsunternehmen testen ja schon KI-gestützte Chatbots im Kundenservice oder automatisierte Schadenportale, wo man einen Autounfall einfach via App meldet und die KI kalkuliert sofort die voraussichtlichen Reparaturkosten. Das ist effizient und praktisch. Für die Unternehmen heißt das: bestimmte Stellenprofile, die es heute gibt, wird es so nicht mehr geben. Es wird alles darauf ankommen, das Verhältnis von Mensch und Maschine sinnvoll auszutarieren. Soziale Präzision ist noch wichtiger als Datenpräzision. Damit aus dem Traum von Hyperskilling nicht ein epochales Entfähigungsprogramm für die meisten wird.
Jetzt kommt jedoch das große Aber: Gerade weil das Einfachere von Maschinen erledigt werden kann, gewinnt das intrinsische, Menschlichere an Bedeutung. Nehmen wir einen schweren Schadenfall – sagen wir, das eigene Haus brennt ab. Eine KI mag den Zahlungsvorgang beschleunigen, aber in so einer Situation sehnen sich viele Menschen nach einem mitfühlenden Gegenüber, nach jemandem, der zuhört, der vielleicht Trost spendet oder einfach versichert „Wir kriegen das gemeinsam hin“. Ein Gegenüber mit einer authentischen Innenseite, das selber Leiden und Lachen kann und nicht bloß eine überzeugende Simulation einer Innenseite vorstellt. Diese emotionale Intelligenz und echte menschliche Empathie darf bereits aus fundamentalen ethischen Gründen nicht an Maschinen delegiert werden. Wenn alles andere austauschbar und automatisiert ist, dann macht der menschliche Faktor im Sinne der moralischen Verantwortung den Unterschied aus – das Vertrauen, das ein Kunde zu einem konkreten Berater oder Betreuer hat. Den nur letzterer steht gerade für das, was er tut.
Weiterhin gibt es Bereiche, in denen menschliche Kreativität und Urteilsfähigkeit wichtig bleiben. Komplexe Risikobewertungen zum Beispiel: Bei neuartigen oder sehr individuellen Risiken braucht es oft Erfahrung, Intuition und interdisziplinäres Denken – da kann KI assistieren, aber die Entscheidung kann ein Underwriter aus Fleisch und Blut treffen, zumindest solange KI nicht wirklich allgemeine menschliche Intelligenz erreicht (worüber wir noch lange diskutieren könnten). Und auch die Aufsicht über KI selbst wird eine neue menschliche Rolle sein: Leute, die die Algorithmen prüfen, Bias erkennen, ethische Richtlinien durchsetzen. Die geradezu Orchestrierung von KI wird Berufbilder und neue Kompetenzen auch in Versicherungen prägen, augmentiertes Arbeiten mit KI-Agenten wird zum daily business. KI ist nicht ein neues Google, kein täglicher Assistent, es ist viel mehr ein neues Lebensbetriebssystem, welches es souverän einzusetzen gilt. Eine Jahrhundertaufgabe.
Für die Mitarbeiter der Branche heißt das natürlich: Ein Weiterbildungs- und Anpassungsprozess steht an. Change und Resilienz werden Kernkompetenzen. Routine-Sachbearbeiter von heute könnten die Datenanalysten oder Kundenbetreuer von morgen sein. Wir müssen unsere Belegschaften mitnehmen, ihnen die Angst nehmen und gleichzeitig ehrlich sagen: „Dein Jobprofil wird sich ändern.“ Aber es heißt nicht automatisch, dass Stellen abgebaut werden müssen – es können auch neue entstehen, wenn man es richtig angeht. Nur denke ich, man wird zunehmend im Unternehmen vor Neuanstellungen die Frage beantworten müssen, warum diesen Job wirklich absehbar keine KI wird leisten können. Und letztlich haben sich die Jobs verlagert, aber der Mensch war immer gefragt für das, was Maschinen nicht konnten. Jetzt wird der Mensch nur dann gefragt bleiben, wenn er sich auf die aus moralischen Gründen infungiblen Elemente konzentriert, die moralischer Verantwortung entsprechen.
Den gesamten Beitrag lesen Sie in der AssCompact September-Ausgabe!
Hier geht’s zum ersten Teil des Beitrages …
Hier geht’s zum zweiten Teil des Beitrages …
zurück zur Übersicht
Beitrag speichern
sharing is caring
Das könnte Sie auch interessieren