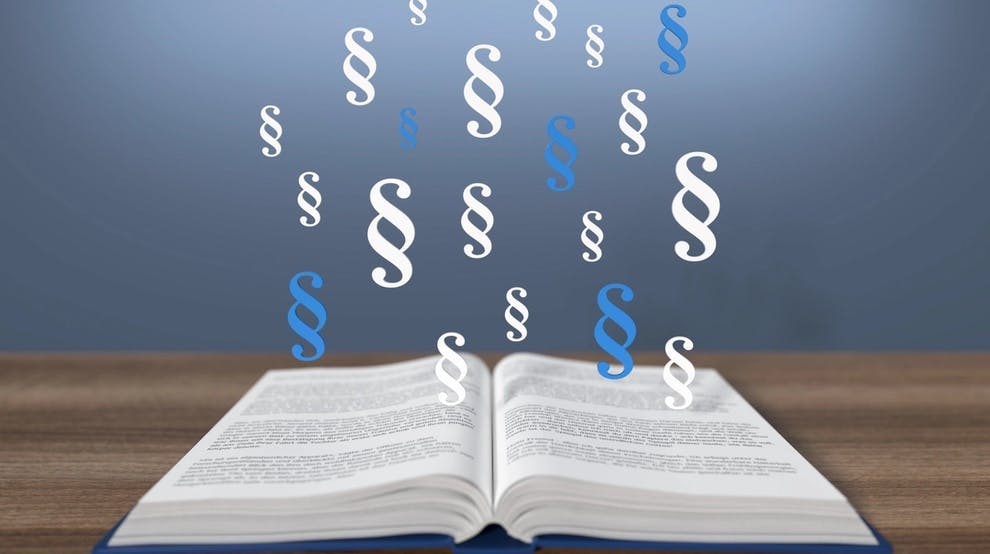Die Frage, ob ein Versicherungsfall dem Privatbereich oder dem Betriebsbereich zuzuordnen ist, zählt zu den äußerst praxisrelevanten Themenstellungen in der Rechtsschutzversicherung. Der Grund liegt auf der Hand: Viele Produkte unterscheiden ausdrücklich zwischen diesen Bereichen – sowohl hinsichtlich der versicherten Risiken als auch in der Prämienkalkulation. Während im Privatbereich ein vergleichsweise homogenes und kalkulierbares Risiko vorliegt, ist der betriebliche Bereich durch ein erheblich differenzierteres Gefahrenpotenzial gekennzeichnet (so der OGH in 7 Ob 190/12k).
Artikel von:
Prof. Mag. Erwin Gisch, MBA
Fachverbandsgeschäftsführer der Versicherungsmakler und Lektor an der Donau Uni Krems, WU-Wien und Juridicum Wien
Systematik der ARB – negative und rudimentäre Umschreibungen
Die ARB enthalten in den Allgemeinen Bestimmungen keine einheitliche Definition, die für sämtliche Rechtsschutz-Bausteine umfassend gilt, sondern verankern die Bereiche in den einzelnen Risikobereichen / Bausteinen. So sieht etwa Art 19 ARB für den Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz vor, dass sich der Versicherungsschutz „je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich“ erstreckt.
- Privatbereich: wird negativ beschrieben als Lebenssachverhalte, die nicht den Berufs- oder Betriebsbereich betreffen.
- Betriebsbereich: wird (eigentlich bloß rudimentär) umschrieben, indem der Versicherungsschutz für den „versicherten Betrieb“ und dessen Arbeitnehmer gilt.
Diese definitorische Leerstelle zwingt dazu, auf Judikatur und Lehre zurückzugreifen, um Abgrenzungskriterien zu entwickeln.
Privatbereich – mehr als „Gefahren des täglichen Lebens“
Der Begriff des „Privatbereichs“ knüpft nach der stRspr an Ereignisse des täglichen Lebens an, die außerhalb von Beruf und Betrieb stattfinden (siehe OGH 7 Ob 218/24w). Anders als in der Privathaftpflichtversicherung wird jedoch nicht bloß auf die „Gefahren des täglichen Lebens“ abgestellt. Vielmehr umfasst der Privatbereich auch komplexe Lebenssachverhalte, solange sie keinen inneren geschäftlichen Charakter tragen.
Der Betriebsbereich – Orientierung am Unternehmensbegriff? Vorsicht…
Der Unternehmensbegriff des § 1 UGB und der Betriebsbereich i.S.d. ARB weisen zwar Überschneidungen auf; dennoch sind sie strikt auseinanderzuhalten.
Der Betriebsbereich wird zwar regelmäßig auch eine organisierte Erwerbstätigkeit beinhalten. Gleichwohl sind die Begriffe „Unternehmen“ iSd UGB und „Betrieb“ iSd ARB nicht deckungsgleich: Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Gründung oder Abwicklung können dem Betriebsbereich zuzurechnen sein, obwohl sie im UGB ggf. nicht als unternehmensbezogen gelten (Vorbereitungsgeschäfte von Einzelunternehmen, § 343 Abs 3 UGB).
Hilfsweise kann jedoch auf Kriterien der Unternehmereigenschaft iSd KSchG (z.B. organisatorischer Aufwand, Einschaltung von Dritten etc.) interpretativ zurückgegriffen werden, um die Abgrenzung Privatbereich vs. Betriebsbereich zu untermauern (siehe OGH 7 Ob 218/24w = versdb 2025, 22. In diesem Sinn bereits Gisch/Weinrauch, [Betriebs-]Rechtsschutzversicherung 18).
Die „sonstige Erwerbstätigkeit“ als Zwischenkategorie
Eine weitere Abgrenzungsebene bildet der Bereich „sonstige Erwerbstätigkeit“. Er umfasst jede auf Dauer ausgerichtete, zur Erzielung von Erträgen oder Vorteilen entwickelte Tätigkeit, die weder Beruf noch Betrieb ist. Ziel dieser Kategorie ist es, Tätigkeiten, die nicht mehr rein privat sind, aber noch keinen vollen betrieblichen Charakter aufweisen, vom Versicherungsschutz im
Während frühere Produkte oftmals eine Definition dessen, was unter nebenberuflicher selbständiger oder sonstiger Erwerbstätigkeit zu verstehen ist, nicht beinhaltet haben, enthalten die ARB / Rechtsschutz-Tarife nun regelmäßig einschlägige Definitionen. Dabei wird üblicherweise der Versicherungsschutz durch zwei Kriterien beschränkt, nämlich durch eine Umsatzgrenze (i.d.R. pro Jahr), die nicht überschritten werden darf, sowie durch eine Streitwertgrenze. Fälle oberhalb dieser Limits sind nicht mehr umfasst.
Abgrenzungskriterium: Innerer sachlicher Zusammenhang
Zentral ist die Frage, ob die Interessenwahrnehmung geschäftlichen Charakter trägt. Die Rechtsprechung stellt auf einen inneren sachlichen Zusammenhang von nicht untergeordneter Bedeutung mit einer unternehmerischen Tätigkeit ab (OGH 7 Ob 190/12k).
- Ausreichend: ein mittelbarer Zusammenhang.
- Nicht ausreichend: ein bloß zufälliger oder lediglich motivierender Zusammenhang.
Somit entscheidet nicht allein, ob der Anlassfall „im Umfeld“ einer Tätigkeit entstanden ist, sondern ob er sachlich mit einer unternehmerischen Betätigung verknüpft ist. Auch die „Zweckwidmung“ scheint nach der Rspr. ein Schlüsselkriterium zu sein.
Blick nach Deutschland
Auch die deutsche Rspr, die überwiegend vom „gewerblichen Bereich“ spricht, verwendet ähnliche Kriterien. Maßgeblich ist, ob die Rechtsstreitigkeit in einem inneren Zusammenhang mit dem Betriebsgeschehen steht. Ein bloß äußerlicher Bezug lässt die Interessenwahrnehmung noch privat erscheinen.
Den gesamten Beitrag lesen Sie in der AssCompact Oktober-Ausgabe!
zurück zur Übersicht
Beitrag speichern
sharing is caring
Das könnte Sie auch interessieren